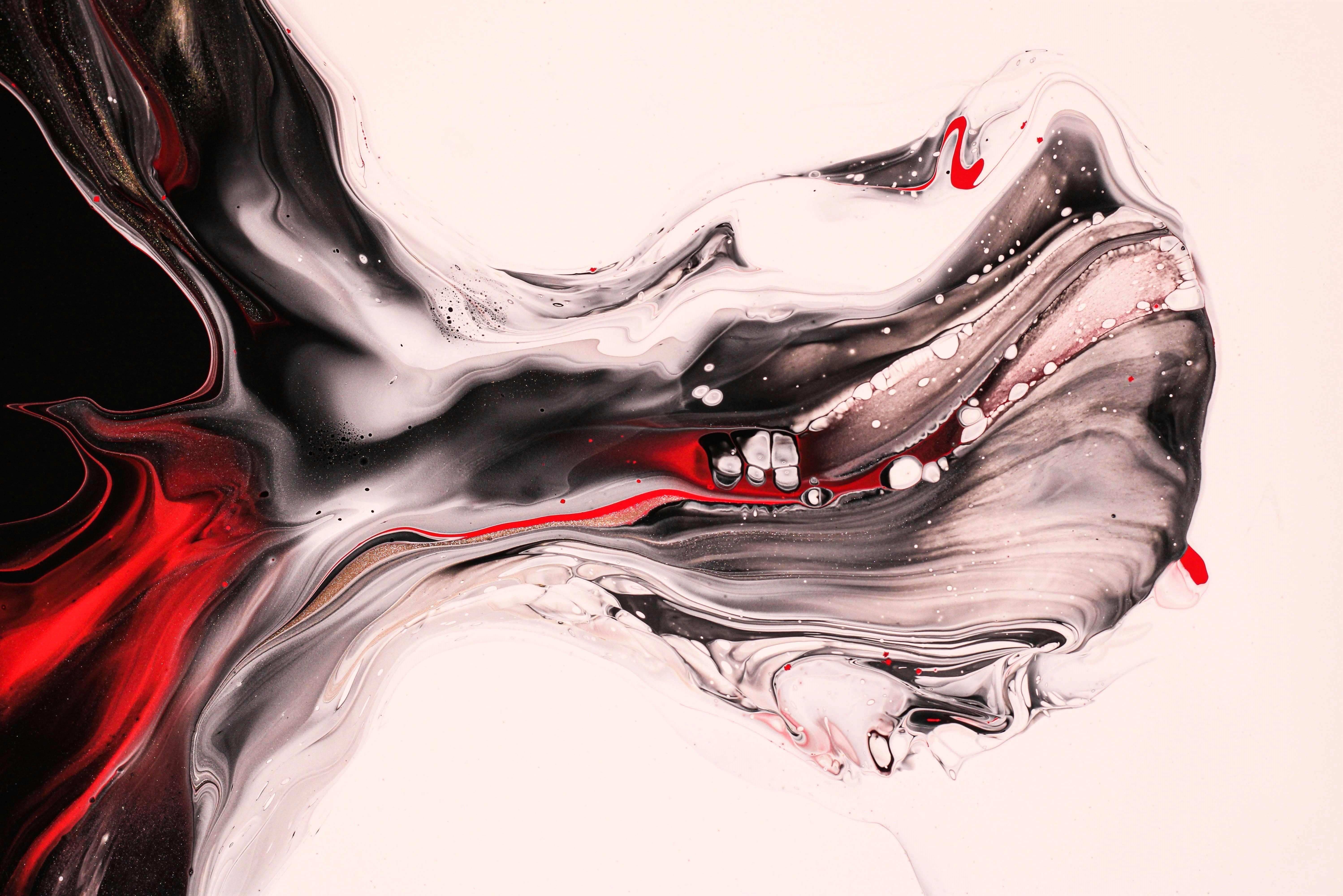
Puccinis Madama Butterfly erzählt nicht nur die tragische Geschichte einer verlassenen Frau. Es geht ebenso um einen Konflikt zwischen unterschiedlichen Kulturen und um imperialistische Ausbeutung. Mit ihrer eindringlichen Musik zeigt die Oper auf zeitlose Weise, wie viel menschliches Leid aus solchen Ungerechtigkeiten entsteht.
»Io scrivo per tutte le razze umane« (»Ich schreibe für alle menschlichen Rassen«), sagte Giacomo Puccini und meinte, dem damaligen Sprachgebrauch folgend: Ich schreibe für die ganze Menschheit. Für keines seiner Werke galt das so wie für Madama Butterfly. In dieser Oper brachte er zum ersten Mal Figuren aus zwei verschiedenen Kulturen zusammen: den amerikanischen Leutnant Benjamin Franklin Pinkerton und die junge japanische Geisha Cio-Cio-San, genannt Butterfly (Schmetterling). In diesem Sinne war Madama Butterfly Neuland für den Komponisten. Zugleich folgte sie seiner Überzeugung, nach der ein guter Opernstoff »Poesie, reichhaltige Dichtung, verschiedenartige Szenen, kleine Dinge, andere weniger klein, aber immer menschlich gefühlt« brauche. Puccini wollte sein Publikum mit Werken zum Weinen bringen, bei denen »durch den dramatischen Einzelfall die Trauer der Welt« hindurchschimmert, wie der Schriftsteller Frank Thiess in seinem Versuch einer Psychologie von Puccinis Musik beschrieb. Die individuelle Tragödie der betrogenen, verlassenen, ihres Kindes beraubten Japanerin ereignet sich in einem Rahmen, der nichts weniger als eine kritische Anklage gegen jegliche Art von Inhumanität, ob sie sich in weltpolitischem Handeln oder in zwischenmenschlichem Verhalten ausdrückt, ist.
Inspiration in London
Sofort nach der Uraufführung von Tosca 1900 begann Puccini nach einem Sujet für eine neue Oper zu suchen. Wie so oft war es ein Theatererlebnis, das den Komponisten für einen Stoff entflammte. Dieses Mal in London, wo er am 21. Juni 1900 ein Stück des amerikanischen Dramatikers David Belasco nach der gleichnamigen Kurzgeschichte von John Luther Long sah, Madame Butterfly. A Tragedy of Japan. Puccini verstand kaum ein Wort – außer ein wenig Schulfranzösisch beherrschte er keine Fremdsprachen. Es spielte keine Rolle. Auch ohne Englischkenntnis erspürte er den Kernkonflikt, die Atmosphäre und die Möglichkeit für musikalisch-szenische Vorgänge.
Das Schicksal der duldsam wartenden Frau, die durch nichts von ihrer Treue zum Vater ihres Kindes abzubringen ist, ließ ihn nicht mehr los. Insbesondere faszinierte ihn die wachend verbrachte Nacht, in der Cio-Cio-San sehnsüchtig die Rückkehr ihres Ehemannes erwartet; der gewiefte Theatermacher Belasco hatte sie mit raffinierter Lichtregie im Zeitraffer einer knappen Viertelstunde bis zum effektvollen Sonnenaufgang dargestellt. Die szenische Einteilung des Librettos gestaltete sich jedoch kompliziert: Belascos einaktiges Schauspiel erzählt nur Pinkertons Wiederkehr nach Nagasaki und die furchtbare Enttäuschung, die er Butterfly bereitet, aber nicht die glückliche Zeit drei Jahre zuvor. Den ersten Akt mit der Exposition der Figuren, der Schilderung der japanischen Gesellschaft, der Hochzeitszeremonie und dem Beginn der ersten Liebesnacht entwickelten die beiden Librettisten, Luigi Illica und Giuseppe Giacosa, deswegen aus Longs Kurzgeschichte.
Der europäische Blick auf Japans Musik
In der Musik verbindet sich japanisches Kolorit mit europäischer Melodik. Puccini holte sich Rat bei einer japanischen Schauspielerin und bei der Frau des japanischen Botschafters in Rom, er konsultierte Notensammlungen und Grammophonaufnahmen japanischer Musik. Was ihm geeignet schien (wie die japanische Nationalhymne beim Erscheinen des kaiserlichen Kommissars), kombinierte er mit eigenen Erfindungen, die er dem asiatischen Idiom nachempfand. Auch die Satzweise – die Singstimme im Einklang mit der Begleitung, Oktaven ohne akkordische Füllung – und pentatonische Wendungen tragen zu dieser Färbung bei.
Wie es ihrer Figur angemessen ist, findet sich im musikalischen Auftreten Cio-Cio-Sans eine Verbindung beider Sphären, von »genrehafter Koloristik« bis »zum Psychogramm heroischer Todeserwartung«, so der Musikjournalist Norbert Christen. In ihrer großen Arie »Un be dì vedremo« aus dem zweiten Akt, in der sie sich ausmalt, wie sie »eines schönen Tages« ihren geliebten Mann zu ihr zurückkehren sieht, ist die von Kirill Petrenko beschriebene Entwicklung ihres Wesens abgeschlossen: »Die Cio-Cio-San des ersten Aktes erscheint von einer Naivität, die größer nicht sein könnte. Sie ist eigentlich noch ein Kind, 15 Jahre alt, wie sie sagt. Aber dahinter steht Cio-Cio-Sans Stärke, ihr unerschütterlicher Glaube an das Ideal der Liebe und der Ehe.«
Im ersten Akt wiederum bot sich genügend Raum, um den männlichen Protagonisten zu porträtieren. Er bildet eine gewisse Bürde für eine Oper. Ein amerikanischer Offizier freut sich über eine Heirat »alla giapponese«, nach japanischer Art, die man einfach dadurch beendet, dass man die Frau wegschickt oder selbst verschwindet. So kann er mit seinem Konsul noch vor der Eheschließung mit Cio-Cio-San auf eine andere zukünftige Gattin anstoßen, auf eine echte, nämlich amerikanische Braut. Die japanischen Gebräuche und Namen erscheinen durch seine Perspektive wie eine Karikatur. Der Co-Librettist Luigi Illica benannte das Problem ohne Umschweife: »Pinkerton è antipatico!«, er ist unsympathisch.
Ein abstoßender Held
Puccini musste vorsichtig ausbalancieren, um Pinkertons Verhalten als falsch erkennbar zu machen, ohne ihn völlig widerwärtig erscheinen zu lassen. An diesem Punkt – einem abstoßenden Helden – geriet die Uraufführung in Mailand zum Debakel, und es begann eine Geschichte fortlaufender Umarbeitungen. Im Zentrum des ursprünglichen zweiten Akts stand die szenische Idee einer ununterbrochen geschilderten Nacht, mit dem berühmt gewordenen »Summchor« als musikalischem Äquivalent für Belascos Beleuchtungseffekte, die Puccini so gut gefallen hatten. Doch in dieser Form war der Akt dem Publikum zu lang, und Puccini teilte ihn in zwei Hälften, mit der Möglichkeit für eine Pause vor dem Morgengrauen. Außerdem milderte er Pinkertons arrogante »Yankee«-Attitüde ab, indem er einige der herablassenden Bemerkungen über die japanische Tradition strich und der Figur eine zusätzliche kurze Arie gab »Addio, fiorito asil« (Lebʼ wohl, mein Blütenreich!), mit der Pinkerton sich, ohne Butterfly noch einmal gesprochen zu haben, von der verlorenen Idylle verabschiedet. Bis an sein Lebensende feilte Puccini weiter an Details, teilweise frühere Entscheidungen revidierend, so dass es heute keine endgültige Fassung der Oper gibt.
Ein Kommentar zu unserer Zeit
Es fällt schwer, Madama Butterfly nicht auch als Kommentar zu unserer Zeit zu lesen, in der, wie Kirill Petrenko sagte, »Menschenhandel […] schon Kinder in die Prostitution zwingt«, in der sich die Mächtigen immer schamloser einfach nehmen, was sie kriegen können und diesen Egoismus in neokolonialistischer Manier nicht einmal verbrämen – und wo die Stimme der Vernunft allzu zaghaft ihre Bedenken anbringt: wie Sharpless, der das Unglück kommen sieht und dennoch nur unzureichend interveniert. Dass Puccini selbst seinen scheiternden, fehlerhaften Figuren mit Menschlichkeit begegnet, zeigt sich daran, dass er Pinkerton über die Erkenntnis seines verdammenswerten Verhaltens hinaus auch Reue fühlen lässt.
Die hinzukomponierte Abschiedsarie war nicht nur ein Zugeständnis ans Publikum, das die Stimme des Tenors am Ende noch einmal aufblühen hören wollte, sondern auch und vor allem ein Zeichen der Hoffnung, dass eine Haltung, in einer anderen, an militärischer Stärke unterlegenen Kultur nur ein »Spielzeug« zu sehen, einem humaneren Miteinander weicht. Den Ausgang gestaltet Puccini musikalisch allerdings offen: Hatte schon der erste Akt harmonisch ambivalent geendet, steht am Schluss der Oper ein G-Dur-Sextakkord (mit der Terz statt des Grundtons im Bass) in extrem weit gespreizter Lage. So klingt keine versöhnliche Trauer – so klingt ein Aufschrei.

Ein Lustspiel mit tödlichem Ausgang
Richard Strauss’ Oper »Salome« haftet (bis heute) der Ruf des Skandals an. Kein Wunder, immerhin wurde sie zeitweise zensiert und die Sopranistin der Uraufführung verweigerte zunächst ihre Teilnahme.

Eine große Liebe
Die Berliner Philharmoniker reisten 1957 mit Herbert von Karajan erstmals nach Japan. Wir blicken zurück auf eine jahrzehntelange Freundschaft mit unserem Publikum vor Ort.

Das Reich des Unaussprechlichen
Die Musik der Romantik als Reise in die Tiefe der Seele