- Interview

Als Gewinner des legendären Chopin-Wettbewerbs und als »Poet am Klavier« (Simon Rattle) hat sich Seong-Jin Cho international einen Namen gemacht. Nun begleitet er die Berliner Philharmoniker als Artist in Residence durch die Saison 2024/25. In unserem Interview erfahren Sie, wann Mikrofone ihn nervös machen, dass die Arbeit eines Pianisten nie endet und warum der Klang des Klaviers von keiner künstlichen Intelligenz ersetzt werden kann.
Herr Cho, in unserer Zeitschrift Phil fragen wir regelmäßig Mitglieder der Berliner Philharmoniker, welchen Beruf sie ergriffen hätten, wenn sie nicht Musiker geworden wären. Wie ist das bei Ihnen?
Das ist eine schwierige Frage. Auch bei einem anderen Berufsweg hätte ich mich wohl für etwas entschieden, bei dem man mit den Händen arbeitet. Hinzu kommt, dass ich ein eher ruhiger, introvertierter Mensch bin. Vielleicht wäre ich Arzt oder Chirurg geworden.
Auch eine andere Karriere als Musiker wäre bei Ihnen denkbar gewesen.
Ich habe tatsächlich sechs Jahre lang als Hobby Geige gespielt, und mein Geigenlehrer in Korea hat mich sehr ermutigt, diesen Weg weiterzugehen. Es gab damals einen Wettbewerb mit Kategorien sowohl für Pianisten als auch für Geiger. Ich habe mit beiden Instrumenten teilgenommen und den dritten Preis beim Geigenwettbewerb gewonnen, während ich im Klavierwettbewerb leer ausgegangen bin. Aber ich habe mich am Klavier immer wohler gefühlt, und auch das dauerhafte Üben fiel mir hier leichter als an der Geige.
Das Klavier war also von Anfang an das Instrument ihrer Wahl?
Ich könnte jetzt sagen, dass mich das Klavier schon immer inspiriert hat, aber das wäre wohl gelogen. Denn ich war erst sechs Jahre alt, als ich anfing, Klavier und Geige zu spielen. Eigentlich habe ich wegen meiner Eltern mit dem Klavierspielen angefangen. In Korea war es üblich, dass man ein Instrument lernt. Ich habe als Kind auch andere Dinge gemacht wie Sport oder Malen, aber klassische Musik war das einzige, das mir wirklich Spaß gemacht hat. Nicht das Üben natürlich, aber das Spielen, das Auftreten und auch das Zuhören. Der Wunsch, Berufsmusiker und vor allem Pianist zu werden, hat sich dann schnell entwickelt – auch wenn ich nicht wirklich wusste, was das bedeutet. Ich habe Videos mit Pianisten gesehen und fand die einfach cool.
Wie muss man sich Ihre Ausbildung in Korea vorstellen?
Die Atmosphäre war sehr wettbewerbsorientiert. Es gab unglaublich viele Musiker, die erfolgreich sein wollten. Ich habe die Hochschule der Künste in Seoul besucht, wo in meinem Jahrgang ungefähr 50 Pianistinnen und Pianisten studierten. Alle haben mehr geübt als ich – mindestens drei oder vier Stunden täglich. Ich verurteile diesen Ehrgeiz gar nicht. Ich glaube, durch dieses Umfeld konnte ich mich selbst formen und mehr Leidenschaft für die Musik entwickeln. Ich hasse den Wettbewerb mit anderen, aber wenn man von solchen leidenschaftlichen Studierenden umgeben ist, inspiriert einen das.
Sie erwähnten vorhin ihr introvertiertes Wesen. Ist der Auftritt auf der Bühne Ihr Weg, Ihre Emotionen mitzuteilen?
Es stimmt schon, dass ich ein eher schüchterner Mensch bin, es fällt mir nicht leicht, über meine Gedanken und Gefühle zu sprechen. Wenn ich auf der Bühne ein Mikrofon in die Hand bekomme, um Worte an das Publikum zu richten, werde ich nervös. Wenn ich aber Klavier spiele, fühle ich mich frei. Dann kann ich machen, was ich will.
Welchen Stellenwert hat für Sie die musikalische Kommunikation mit dem Publikum?
Ich muss gestehen, dass mir der Komponist etwas mehr am Herzen liegt als das Publikum. Es klingt vielleicht egozentrisch, aber ich glaube, meine Aufgabe besteht vor allem darin, den Komponisten, seine Musik, seine Sprache und seine Emotionen immer besser zu verstehen. Im nächsten Schritt versuche ich dann, all das dem Publikum zu vermitteln.
Es ist nicht leicht, Musik wirklich zu verstehen. Haben Sie dafür eine Strategie?
Das ist ein langer Prozess. Als Erstes arbeite ich intensiv am Notentext, dann studiere ich den Hintergrund eines Komponisten oder eines Werkes. Es gibt so unendlich viele Möglichkeiten, etwa eine Sonate oder ein Konzert von Beethoven zu spielen. Daher ändern sich meine Interpretationen von Jahr zu Jahr. Das ist für mich der faszinierendste Teil des Musikerdaseins.
Was wäre ein Beispiel für eine solche kontinuierliche Interpretationsänderung?
Nehmen Sie Beethovens Fünftes Klavierkonzert, das ich im März 2025 mit den Berliner Philharmonikern aufführen werde. Ich spiele dieses Stück, seit ich 14 bin, also seit 15 oder 16 Jahren. Ich war schon als Kind von diesem brillanten und dramatischen Ausdruck beeindruckt. Aber inzwischen fühle ich, dass es da noch weitere Ebenen gibt. Diese Musik ist eben nicht nur feurig, sondern auch lyrisch, tief und breit. Entsprechend ändert sich mein Ansatz. Und in zehn oder zwanzig Jahren werde ich das Stück wahrscheinlich wieder anders spielen. Das alles ist eine lebenslange Reise, auf der ich meine eigene Interpretation und meine eigene Stimme finde.
Manche werden vielleicht überrascht sein: Sie sind ein berühmter Pianist, der den Chopin-Wettbewerb gewonnen hat und mit großen Orchestern auftritt – und trotzdem wollen Sie immer noch weiter. Haben Sie ein Fernziel auf dieser Reise, eine künstlerische Vision?
Jeder Pianist und jede Pianistin hat einen eigenen Klang. Den kann man nur schwer ändern – so wie man nicht ohne Weiteres Tenor werden kann, wenn man eine Bassstimme hat. Man kann seinen Klang aber entwickeln. Diese Reise endet nie, es gibt in diesem Beruf keine Errungenschaften. Es ist wunderbar, Wettbewerbe zu gewinnen und mit renommierten Orchestern zu spielen. Auch die Residency bei den Berliner Philharmonikern ist für mich eine große Ehre. Aber das wirkliche Ziel liegt in musikalischer Tiefe.
Was bedeutet es rein technisch, als Pianist den eigenen Klang zu entwickeln? Wie geht man da vor?
Das ist schwer zu erklären. Grundsätzlich ist jeder Konzertabend anders als der vorherige, das macht das Musizieren ja so aufregend. Was nun den Klang eines Pianisten insgesamt angeht – ich denke, der ändert sich wie ein menschliches Gesicht. Man merkt nicht, dass man älter wird, aber irgendwann schaut man in den Spiegel und sieht die Veränderung. Das klingt magisch, aber der Klang eines Klaviers hat überhaupt etwas Magisches an sich. Den wird keine künstliche Intelligenz je ersetzen.
Wenn Sie über Ihre musikalische Entwicklung nachdenken, habe Sie dann auch einen Plan für Ihr Repertoire?
Ich habe seit meiner Teenager-Zeit mit vielen großen Musikerinnen und Musikern gesprochen und immer wieder den Rat gehört: »Lerne neue Stücke, bis du 40 bist, danach wird es schwierig.« Ich habe dann als 17-jähriger Schüler in einem Notizbuch das Repertoire aufgeschrieben, das ich bis 40 lernen wollte. Dieses Notizbuch habe ich immer noch. Jetzt werde ich 30 und habe fast die Hälfte meiner Liste abgearbeitet.
Das klingt ungewöhnlich diszipliniert.
Es ist wie mit Sprachen, die man auch besser lernt, wenn man jung ist. Ich habe allerdings keinen detaillierten Plan zur Reihenfolge. Ich möchte als Nächstes mehr Beethoven und Brahms spielen und auch Ravel, dessen gesamte Klaviermusik ich hier in Berlin aufführen werde. Als Pianist hat man ja das große Glück, dass es sehr viel Repertoire gibt.
Während Ihrer Zeit als Artist in Residence der Berliner Philharmoniker erfährt man einiges über Ihre aktuellen Repertoire-Schwerpunkte. Es gibt zum Beispiel eine Art ungarischen Kammermusikabend mit Brahms, Ligeti und Bartók. Wie ist diese Idee entstanden?
Es war für mich wie im Paradies, als ich das Programm für die Residency kuratieren durfte. Der von Ihnen erwähnte Kammermusikabend ist tatsächlich als Panorama ungarischer Musikstile gedacht. Brahms war bekanntlich von dieser Musik inspiriert, wie am offensichtlichsten seine Ungarischen Tänze zeigen. Ich liebe alles von Brahms, und gerade das Klarinetten-Trio, für das ich mich entschieden habe, ist unglaublich schön. Außerdem gefiel mir, dass ich hier nicht nur mit Streichern spiele. Das Ligeti-Werk für Violine, Horn und Klavier hat ebenfalls eine spannende Besetzung und passt bestens dazu. Schließlich gibt es noch das Bartók-Quintett, das ich als 19-Jähriger während meines Studiums in Paris kennengelernt habe. Es ist ein sehr frühes Stück, das nicht oft gespielt wird und nicht wie typischer Bartók klingt. Aber trotzdem spürt man Bartóks musikalische Zukunft. Ich hoffe, das Programm gefällt dem Publikum.
Sie erwähnten ein weiteres ungewöhnliches Projekt: die Aufführung sämtlicher Klavierwerke Ravels an einem Abend. Ist das nicht ein sehr mutiges Vorhaben?
Es wird auf alle Fälle für mich sehr anstrengend, körperlich und geistig, weshalb wir zwei Pausen haben werden. Aber ich wollte dieses Programm schon immer machen. Und 2025 ist Ravels 150. Geburtstag, den möchte ich damit feiern.
Ravel hatte eine eher distanzierte, ja rätselhafte Persönlichkeit. Glauben Sie, dass man durch eine solche Gesamtaufführung seiner Klaviermusik dem Menschen Ravel näherkommt?
Ich denke, Ravel war ein Perfektionist. Seine Musik ist ganz anders als die von Debussy, die in gewisser Weise fantasievoller und romantischer ist. Ravel dagegen war ein scharfer Denker mit sehr klaren Ideen. Und dann gibt es bei ihm diesen unglaublichen Reichtum an Farben – selbst seine Klaviermusik hat oft einen orchestralen Klang.
Aber ist es auch eine emotionale Musik? Oder schließen sich Emotion und Perfektion aus?
Ich glaube, man kann auf viele Arten emotional sein. Wenn ich zum Beispiel Tschaikowskys Erstes Klavierkonzert spiele, sehe ich einen Menschen vor mir, der laut aufschreit. Wenn ich Brahms spiele, vor allem seine späte Musik, stelle ich mir eher jemanden vor, der traurig ist, fast depressiv. Er schreit nicht, sondern ist ganz innerlich. Und auch Ravels Musik wirkt auf mich sehr emotional. Hier stelle ich mir einen Menschen vor, der leise lächelt, aber in seinen Augen stehen Tränen. Im Leben gibt es eben die unterschiedlichsten Gefühle.
Das zeigen auch die beiden Solokonzerte, die Sie während Ihrer Residency mit den Berliner Philharmonikern spielen werden und die in ihrem Ausdruck kaum gegensätzlicher sein könnten: das Erste Klavierkonzert von Schostakowitsch und das Fünfte Klavierkonzert von Beethoven.
Als ich gefragt wurde, welche Konzerte ich am liebsten mit den Berliner Philharmonikern spielen möchte, war mir klar, dass ein Werk des deutschen Repertoires dabei sein sollte. So kam ich auf das Beethoven-Konzert, mit dem ich mich beschäftige, seit ich Teenager bin, und das die Berliner Philharmoniker sicherlich wundervoll spielen werden. An Schostakowitschs Musik wiederum mag ich, dass sie sehr sarkastisch ist. Ich liebe schwarzen Humor und meine Freunde finden, dass ich selbst zum Sarkasmus neige. Wobei dieses Werk nicht nur schwarzen Humor hat, sondern auch lyrische Tiefe.
Welche Rolle spielt für Sie, dass dies eigentlich ein Doppelkonzert für Klavier und Trompete ist?
Auch das hat mir gefallen, denn in unserer Aufführung wird Guillaume Jehl [Solotrompeter der Berliner Philharmoniker, d. Red.] den Trompetenpart spielen. Ich kenne ihn von unserer ersten gemeinsamen Tournee, und ich freue mich sehr darauf, das Werk mit ihm zu spielen.
Sie sprechen damit Ihre erste Begegnung mit den Berliner Philharmonikern an. Das war 2017, als Sie Einspringer für Lang Lang waren – erst in Berlin, anschließend auf der letzten Asien-Tournee von Simon Rattle. Im November 2023 haben Sie dann mit dem Orchester unter Leitung von Kirill Petrenko in Seoul gespielt. Wie hat sich Ihr Verhältnis zu den Berliner Philharmonikern in dieser Zeit entwickelt?
Es ist heute ganz anders als damals. Bei meinem Debüt war ich 23 und gerade nach Berlin gezogen. Ich war sehr nervös und hatte noch kaum Freunde im Orchester, außer etwa Daishin Kashimoto und Emmanuel Pahud, die ich vom Festival in Salon-de-Provence kannte. Während der ersten Tournee sind wir uns dann nähergekommen, das hat wirklich Spaß gemacht. 2020 haben wir während der Pandemie noch ein gemeinsames Online-Konzert mit Andris Nelsons gespielt – ohne Publikum, was für mich eine besondere Erfahrung war. Und zuletzt gab es das Gastspiel in Korea mit Maestro Petrenko, das für mich eine ganz große Freude war. Ich habe den größten Respekt vor diesem Orchester und fühle mich mit ihm heute sehr viel wohler als vor sechs Jahren. Ich denke, dies sind alles großartige Musikerinnen und Musiker und großartige Menschen.
Seong-Jin Cho beantwortet 5 Fragen auf dem Klavier
Seong-Jin Cho wurde 1994 in Seoul geboren und gab sein erstes Konzert mit 11 Jahren. Er studierte in seiner Heimatstadt und von 2012 bis 2015 bei Michel Béroff in Paris. 2011 gewann er den dritten Preis beim Internationalen Tschaikowsky-Wettbewerb in Moskau, 2015 sorgte er für weltweite Aufmerksamkeit, als er den 17. Internationalen Chopin-Wettbewerb in Warschau für sich entschied. Seither tritt er in den großen Konzertsälen und mit den renommiertesten Orchestern der Welt auf.

Aufheiterung in schlaflosen Nächten
Das Rätsel der »Goldberg-Variationen«

Kleines Klavierlexikon
Prélude, Nocturne, Sonate, Etüde – in unserem kleinen Klavierlexikon stellen wir Ihnen die wichtigen Genres der Klaviermusik vor.
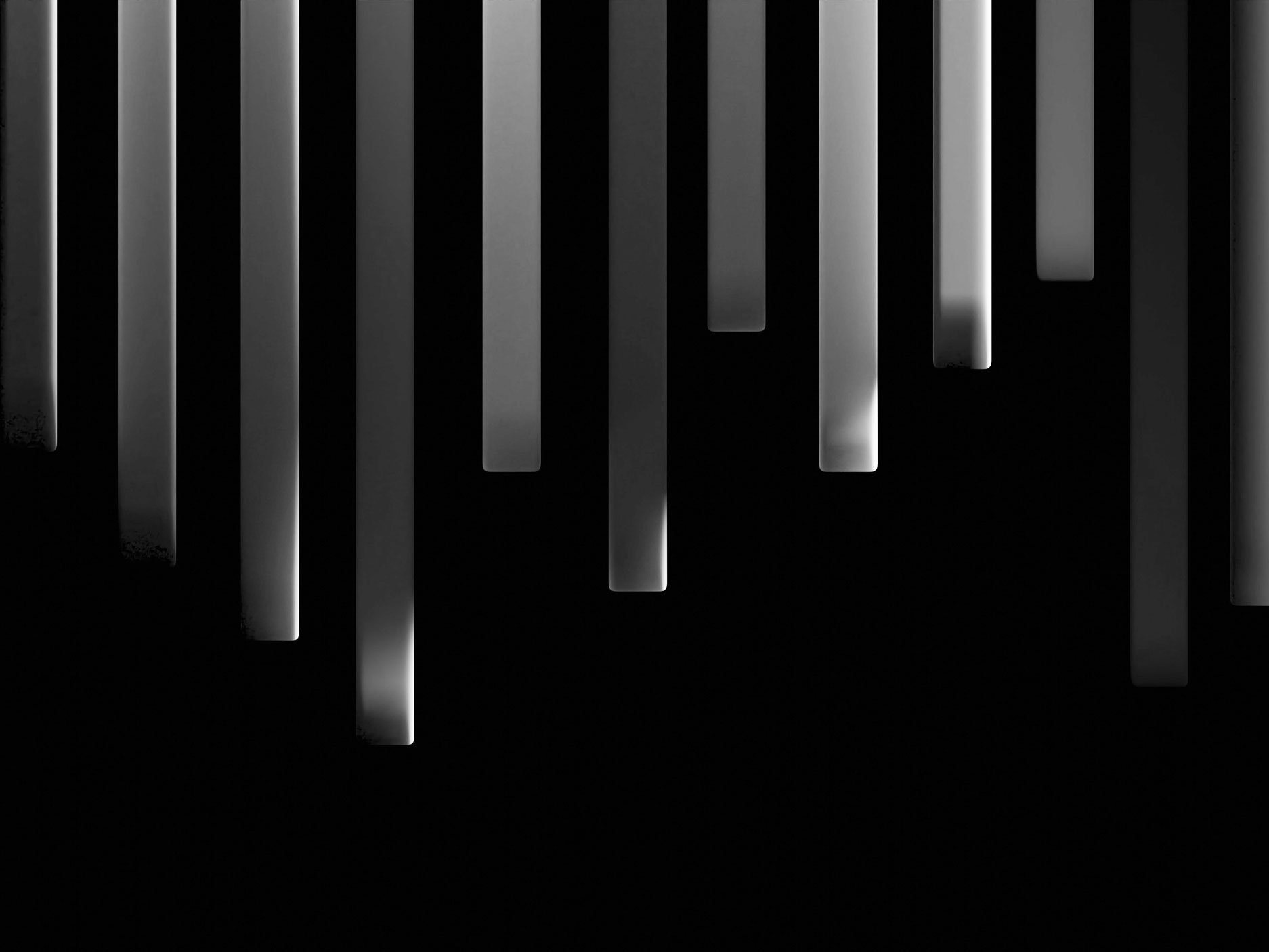
Rasanter Tastenzauber
Beethoven war ein Wunderkind am Klavier und feierte zu Beginn seiner Laufbahn seine größten Erfolge als Pianist. Bis sich sein Gehör verschlechterte.